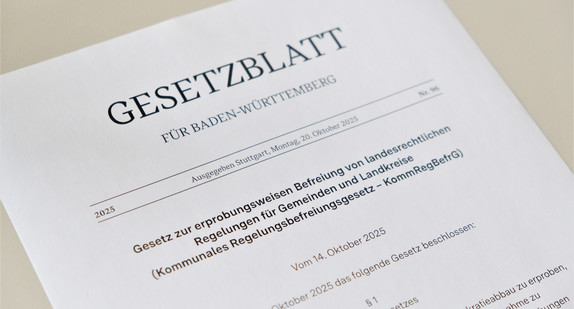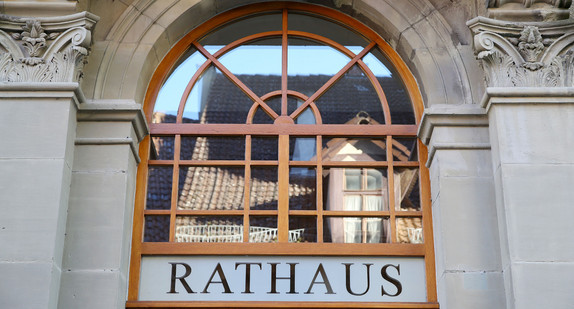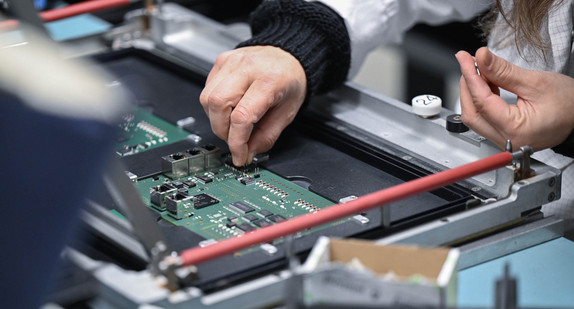Die Welt verändert sich: vieles wird komplexer und unsicherer. Auch die Verwaltung muss sich darauf einstellen. Mit dem Masterplan für die Transformation der Verwaltung macht die Landesregierung genau das. Wir denken die Verwaltung neu: modern, digital und bürgernah.
Kulturwandel statt starrer Strukturen
Der Masterplan ist kein starres Konzept, sondern ein lebendiger Prozess. Ziel ist es, sich noch stärker an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren. Dabei nehmen wir die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Mitarbeitenden in der Verwaltung in den Blick. Dafür modernisieren wir – beginnend mit den Landesministerien – die Strukturen, Abläufe und die Art, wie wir arbeiten.
Seit 2025 gehen wir sogar noch einen Schritt weiter: Der Masterplan bezieht jetzt auch die Regierungspräsidien im Land mit ein. Das heißt: wir teilen erfolgreiche Maßnahmen und „Best-Practices“. Gemeinsam mit vielen Beteiligten treiben wir so die Modernisierung voran und machen die Verwaltung Stück für Stück zukunftsfähiger.
Wie sieht die Verwaltung von morgen aus?
Wir haben ein klares Bild, wo es hingehen soll und was eine moderne Verwaltung ausmacht:
- Wir arbeiten effizient und ergebnisorientiert.
- Wir machen exzellentes Personalmanagement.
- Wir managen Projekte exzellent.
- Wir arbeiten konsequent menschenzentriert.
- Wir schaffen Raum für Innovation und kontinuierliche Verbesserung.
- Wir leben moderne Führung.
Neue Ideen ausprobieren
Um die Ziele zu erreichen, setzt die Landesverwaltung zahlreiche Projekte um, in denen Mitarbeitende zum Beispiel neue Arbeitsmethoden testen können. Insgesamt umfasst der Masterplan bereits über 50 Projekte.
Manchmal ist es besser, eine Idee einfach auszuprobieren, statt lange zu planen. Genau das machen wir mit den „Transformationspiloten“. Die neuen Ansätze werden in einer Minimalversion drei Monate lang getestet. Wenn sich ein Projekt bewährt, wird es weiterentwickelt.
Erste Pilotprojekte liefen bereits 2023, 2024 und 2025. Weitere Runden sind in Planung.
Grundlegende Veränderungen vorantreiben
Parallel bündeln strategische Projekte, die „Pathfinder“, Wissen über Behörden hinweg. Im Gegensatz zu den kleineren Pilotprojekten setzen sie langfristige Schwerpunkte bei der Verwaltungsmodernisierung. Interdisziplinäre Teams bearbeiten hier Schlüsselthemen für eine moderne Verwaltung und stützen sich dabei auf Erfahrungen aus vorherigen Projekten.
Ziel ist es, erfolgreiche Ansätze für die gesamte Landesverwaltung einzuführen – damit alle davon profitieren.
Sechs dieser wegweisenden Projekte laufen derzeit in der Landesverwaltung.
Im Staatsministerium koordiniert das Team des „TränsformerHub_bw“ die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zum Masterplan. Es gibt den Takt vor, setzt Impulse und unterstützt den Chef der Staatskanzlei bei seinen Aufgaben.
In den Ministerien und Regierungspräsidien gibt es Ansprechpersonen für die Verwaltungsmodernisierung. Sie teilen ihr Wissen und verbessern die Kommunikation rund um die Umsetzung des Masterplans. Die Einheiten sind über die Behörden des jeweiligen Ministeriums hinaus vernetzt und arbeiten eng mit dem TränsformerHub_bw im Staatsministerium zusammen.
Immer mehr Unternehmen setzen auf agile Methoden wie „SCRUM“ (flexibles Arbeiten in kurzen Projektphasen) oder „Design Thinking“ (Ideen mit Nutzerfokus entwickeln). Ein internes Netzwerk aus Expertinnen und Experten, der „Tränsformer-Pool“, baut notwendiges Fachwissen auf und trägt es in die Behörden.
Eine moderne Verwaltung braucht moderne Führungskräfte. Ein neues Tool hilft Führungskräften dabei, eigene Stärken und Schwächen besser zu erkennen und sich gezielt weiterzubilden.
Reformen scheitern oft nicht an Konzepten, sondern an der Haltung. Das Projekt „Mindset-Expedition“ unterstützt Mitarbeitende in der Verwaltung dabei, sich auf neue Prozesse und Arbeitsweisen einzulassen.
Um Verwaltungsprozesse bürgernah zu optimieren, setzt das Projekt „Automatisierte Verwaltung“ auf Prozessoptimierung, Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen und bringt die Ministerien dazu in den Austausch.
Große Projekte für die Transformation
Neben den Projekten des Masterplans liefern größere Transformationsprojekte wertvolle Impulse. Dazu gehören beispielsweise das neue Corporate Design des Landes, die KI-gestützte Textassistenz für Behörden F13, die Cloud-Plattform MEDI:CUS für Gesundheitsdaten oder TextLab, eine Software für verständliche Sprache.
Erfolgreiche Lösungen ausbauen
Erfolgreiche Projekte und Maßnahmen der Landesregierung werden als bewährte Methoden eingebunden. Die digitale E-Akte, die Task Force Erneuerbare Energien, die Strategiedialoge des Staatsministeriums oder die Servicestelle Bürgerbeteiligung sind nur einige Beispiele für nachhaltige Modernisierung.
Kontakt

Staatsminister Jörg Krauss
Koordinator der Landesregierung für Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung
Staatsministerium Baden-Württemberg Richard-Wagner-Straße 15 70184 Stuttgart