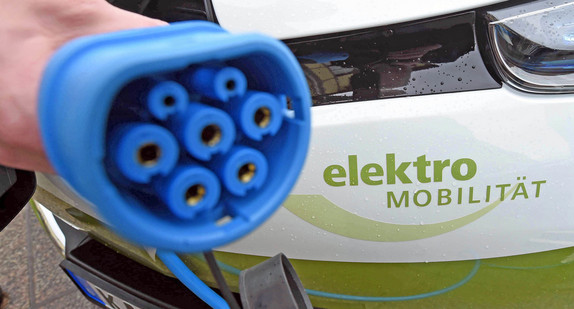Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus hat eine Studie zu antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung vorgestellt. Die Studie zeigt, dass sich die Art, wie Antisemitismus geäußert wird, verschiebt. Der Glaube an antisemitische Verschwörungsmythen wird auch im Zuge der Corona-Proteste deutlich sichtbar.
„Mit Sorge beobachten wir die Gefahren von Antisemitismus, die nicht zuletzt durch Digitalisierung noch einmal gewachsen sind: Verschwörungsgläubige vernetzen und radikalisieren sich mitunter bis zur Gewaltbereitschaft. Um zielgerichtete Maßnahmen gegen Verschwörungsmythen entwickeln zu können, brauchen wir einen Überblick darüber, mit welcher Verbreitung des Phänomens wir es zu tun haben. Ich bin daher sehr froh, dass wir mit unseren Partnern von der Universität Leipzig zum zweiten Mal eine Auswertung zur Verbreitung judenfeindlicher Einstellungen in unserer Gesellschaft erstellen konnten, die wir heute vorstellen“, sagte der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Dr. Michael Blume, bei der Vorstellung der Sekundärauswertung der Leipziger Autoritarismus Studien für Baden-Württemberg (PDF).
Dr. Blume dankte dem Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig, welches schon seit 2002 regelmäßige Erhebungen für die gesamte Bundesrepublik in Bezug auf Autoritarismus durchführt. 2019 wurden Prof. Dr. Oliver Decker, der Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung, und sein Team erstmals darum gebeten, eine Auswertung für Baden-Württemberg vorzunehmen, um spezifische Daten für das Land zu erhalten. Diese wurden im ersten Antisemitismusbericht an den Landtag vorgestellt. „Nun folgen die neusten Daten für 2020 – ein Jahr, in dem auch die Corona-Pandemie spürbare Auswirkungen auf Antisemitismus und Verschwörungsmythen hatte“, führte Dr. Blume aus.
Rückgang bei klassischen antisemitischen Einstellungen
In der vorgestellten Studie baten die Forschenden die Teilnehmenden um Zustimmung oder Ablehnung zu unterschiedlichen Aussagen und fanden heraus, dass 2019 mehr als fünf Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg fest verankerte antisemitische Einstellungen hatten. Demgegenüber konnte 2020 ein Rückgang festgestellt werden: Nur noch etwas mehr als zwei Prozent der Menschen haben sogenannte klassische judenfeindliche Ansichten, und stimmen beispielsweise der Aussage „Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß“ zu. „Dass wir wieder einen Rückgang bei klassischen antisemitischen Einstellungen verzeichnen können, stimmt mich hoffnungsvoll. Ich bin überzeugt, dass die Arbeit der Zivilgesellschaft, seriöser Medien und Politik damit erste Früchte trägt“, äußerte Blume. „Umso wichtiger ist es, jetzt nicht nachzulassen. Wir brauchen weiterhin Aufklärung der Menschen darüber, wie Antisemitismus entsteht und wie er wirkt.“ Er sei dankbar, dass immer mehr Schulen, Vereine oder staatliche Stellen Fortbildungsangebote annehmen. Einen wichtigen Schritt hätten auch Innenministerium und jüdische Landesgemeinden durch die Benennung von zwei Polizeirabbinern unternommen. Für die nahe Zukunft habe er zudem die Gründung eines deutsch-israelischen Begegnungswerkes vorgeschlagen, so Blume weiter.
Israelbezogener Antisemitismus spielt weiterhin eine Rolle
„Klassische antisemitische Einstellungen gehen zurück. Aber dafür sehen wir, wie antisemitische Verschwörungsmythen über Umwege aufrechterhalten werden“, erklärte Blume weiter. „So zeigt die Studie, dass der israelbezogene Antisemitismus weiterhin eine Rolle spielt. Dabei wird Israel gezielt dämonisiert und nicht selten mit dem Nazi-Regime gleichgesetzt.“ Auch Prof. Decker und sein Team führten aus: „Der Antisemitismus ist eine beständige Herausforderung. Der Hass auf Israel sowie Verschwörungserzählungen sind auch Äußerungsformen des Antisemitismus. Nur solange es gelingt, seine Funktion zu verstehen und ihn zu erfassen, können wir auch wirksam auf diese Bedrohung der demokratischen Gesellschaft reagieren.“ Antisemitismus sei eine dunkle Ressource, die in Krisen für viele Menschen attraktiv werde. „COVID-19 wirkt dabei als Brandbeschleuniger: Die weit verbreitete Verschwörungsmentalität macht auch offen antisemitische Ressentiments wieder salonfähig“, so Prof. Decker. Dabei stellten antisemitische Vorfälle auf Demonstrationen der sogenannten „Querdenken“-Bewegung kein Novum dar, sondern seien Ausdruck alter Ressentiments. Es werde auch deutlich, dass nicht nur Menschen aus den Rändern der Gesellschaft antisemitisch denken und handeln, sondern, dass sich Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft zeige.
Konstant hoher Prozentsatz glaubt an Verschwörungsmythen
Blume äußerte sich besorgt über den weiterhin konstant hohen Prozentsatz von Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben. Die Auswertung zeige, dass fast 39 Prozent der Menschen folgende Auffassung teilen: „Die Corona-Krise wurde so groß geredet, damit einige wenige von ihr profitieren können.“ Weitere 31 Prozent stimmen der Aussage „Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte“ zu. „An diesem Punkt müssen wir dringend weiter ansetzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Jüdinnen und Juden durch Verschwörungsvorwürfe verleumdet und angegriffen werden“, forderte Blume.
Susanne Jakubowski vom Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg äußerte sich besorgt über die Verunsicherung von Jüdinnen und Juden im Land: „Deinen Davidstern um den Hals solltest Du nicht immer offen tragen. Es gibt Menschen, die uns nicht mögen“ – so laute eine Aussage, die jede jüdische Mutter und jeder jüdische Vater nur allzu häufig treffen müsste.
Anstieg bei antisemitisch motivierten Straftaten
Die Psychologin Marina Chernivsky bewertete die Studienergebnisse wie folgt: „Die hohen Zustimmungswerte für Verschwörungsmythen und israelbezogenen Antisemitismus sowie die steigenden Fallzahlen antisemitischer Gewalt untermauern die Kontinuität, aber auch die Radikalisierung antisemitischer Dynamiken in unserer Gesellschaft.“ Daher sieht Chernivsky als Leiterin der Beratungsstelle OFEK BaWü ihre Aufgabe darin, die Effekte antisemitischer Bedrohung sichtbar zu machen und professionelle Angebote für Betroffene und Institutionen zu entwickeln.
Abschließend fokussierte Dr. Blume Radikalisierungstendenzen unter dem Aspekt digitaler Medien: „Wenn auch nicht die Zahl der Antisemiten steigt, so bewirkt doch die Vernetzung auf Facebook, Telegram, Discord und anderen Online-Kanälen mitunter eine Radikalisierung bis zur Gewaltbereitschaft. Digitalsekten wie QAnon und Teile der Querdenken-Bewegung verbreiten Hass und Gewaltbereitschaft gegen Jüdinnen und Juden, aber auch etwa gegen Journalistinnen und gewählte Politiker. Daher sehen wir leider auch einen Anstieg bei antisemitisch motivierten Straftaten.“
Staatsministerium: Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus