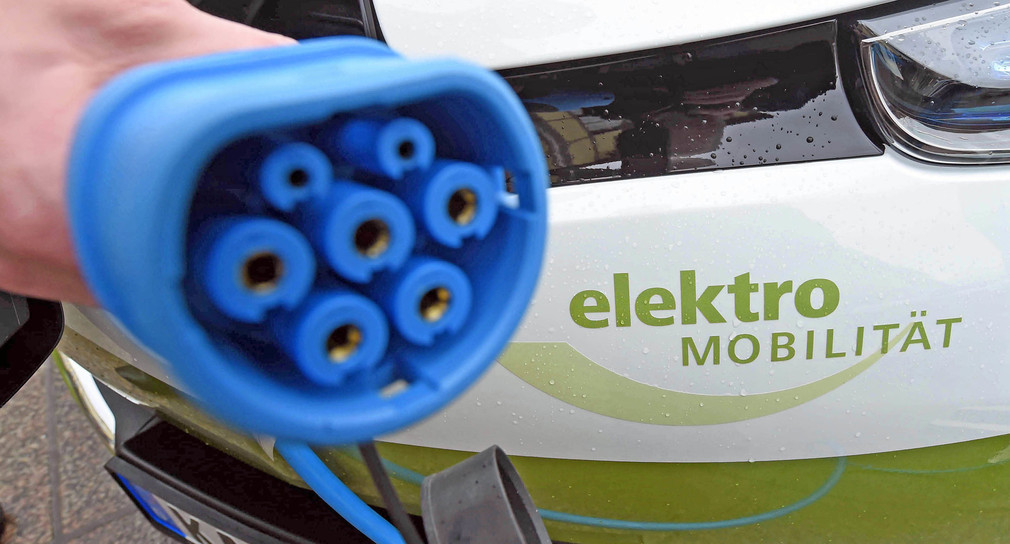Mit einem 10-Punkte-Papier zur Stärkung des Automobilstandorts Deutschland und Europa (PDF) bringt sich Baden-Württemberg in den Strategiedialog über die Zukunft der Automobilindustrie der Europäischen Kommission ein, der unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 30. Januar 2025 gestartet ist. Die Landesregierung fordert unter anderem eine sofortige Überprüfung der CO2-Flottenziele für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und für LKW, sowie eine Aussetzung möglicher Strafzahlungen während der Überprüfung, den zügigen Ausbau der EU-weiten Lade- und Wasserstoff-Tankinfrastruktur und eine Senkung der Strompreise an den Ladesäulen.
„Wir müssen in Europa den Binnenmarkt stärken und auf Innovationen setzen. Das vernetzte Auto der Zukunft muss in Europa und Baden-Württemberg vom Band rollen. Automobilwirtschaft und Politik tragen beide eine große Verantwortung dafür, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Elektromobilität zu stärken“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Brüssel am Rande der auswärtigen Kabinettssitzung. Bereits am Vorabend hatte Kretschmann sich gemeinsam mit weiteren Kabinettsmitgliedern dazu mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission in der baden-württembergischen Landesvertretung ausgetauscht.
Wir müssen alles daransetzen, den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen und die notwendigen Rahmenbedingungen dafür auf europäischer Ebene bereitstellen.
„An der Automobilwirtschaft wird sich exemplarisch zeigen, wie es mit der europäischen Wirtschaft in den kommenden Jahren weitergeht“, betonte Kretschmann weiter. „An dieser Leitindustrie hängen große Hersteller genauso wie viele kleine und mittlere Zulieferer, verstreut in ganz Europa. Die Automobilwirtschaft investiert Milliarden in die Transformation, der Umstieg auf klimaneutrale Fahrzeuge geht jedoch nicht so schnell voran wie gehofft. Dazu kommen drohende Handelskonflikte und Strafzahlungen. Wir müssen deshalb alles daransetzen, den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen und die notwendigen Rahmenbedingungen dafür auf europäischer Ebene bereitstellen. Dazu gehört ein verlässliches Netz an Ladesäulen mit attraktiven Preisen. Das ist ganz entscheidend dafür, dass die Leute sich für den Kauf eines E-Autos entscheiden. Europa muss insgesamt einfacher, schneller, dynamischer werden.“
Der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl ergänzte: „Wir sind die Wiege des Automobils. Autos made in Germany waren seit jeher mit die besten, sichersten und innovativsten der Welt. Das darf nicht nur Bilanz vergangener Zeiten, sondern muss auch der Anspruch für die Zukunft sein. Wir stehen vor einer Zeitenwende, nicht zuletzt, weil die Digitalisierung und neue Antriebstechnologien den Automobilmarkt komplett umkrempeln. Umso mehr müssen wir die Weichen für eine wettbewerbsfähige baden-württembergische Automobilwirtschaft stellen und damit auch die Voraussetzung für Technologieoffenheit schaffen.“
Strategiedialog bündelt Expertise aus Politik und Wirtschaft
Kretschmann unterstrich, dass Europa in den zentralen Wirtschaftsbereichen eine gut durchdachte, langfristig ausgerichtete Strategie und Industriepolitik brauche, um die Herausforderungen anzugehen. „Wir haben vor mehr als sieben Jahren in Baden-Württemberg mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft BW ein Bündnis geschaffen, in dem wir strukturiert zusammenarbeiten. Gewerkschaften, Hersteller, Zulieferer, Wissenschaft, Organisationen, Verbände und Politik haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Herausgekommen ist eine wichtige Allianz zwischen Politik und Wirtschaft, die gemeinsam die zentralen Transformationsthemen vorangetrieben hat. Aber klar ist auch: Um die großen Schalthebel bewegen zu können, braucht es Europa. Und deshalb freut es mich sehr, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun ein ähnliches Format auf europäischer Ebene eingerichtet hat.“ Gleichzeitig forderte Kretschmann, neben dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten auch die europäischen Automobilregionen in den europäischen Strategiedialog eng einzubinden. „Schließlich setzen wir vor Ort um, was europäisch entschieden wird.“
Kabinett tagt in Brüssel zu europapolitischen Themen
Das Landeskabinett tagt am Dienstag, 4. Februar 2025, in der Landesvertretung in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die europapolitisch strategischen Schwerpunkte der Ministerien im Jahr 2025 und die Anliegen der Landesregierung für den Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027. Im Rahmen des Brüssel-Besuchs spricht Ministerpräsident Kretschmann mit EU-Kommissar Wopke Hoekstra, zuständig für Klima, Netto-Null-Emissionen und sauberes Wachstum, EU-Kommissarin Ekaterina Zachariewa, zuständig für Startups, Forschung und Innovation, sowie mit Botschafter Michael Clauß, Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der EU. Am Abend lädt die Landesregierung zu einem Neujahrsempfang in die Landesvertretung, an dem auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnimmt.
10-Punkte-Papier
Den Automobilstandort Deutschland und Europa mit klarer Agenda stärken und Arbeitskräfte sichern
Die deutsche und europäische Automobilwirtschaft steht unter enormem wirtschaftlichen Druck. Die Lage ist in Teilen dramatisch. Der Wettbewerb ist in allen internationalen Märkten sehr herausfordernd und aktuell von Überkapazitäten geprägt. Das betrifft auch den europäischen Markt und die deutschen und europäischen Produktionsstandorte. Eine veränderte geopolitische Lage, eine schwächelnde Konjunktur und Handelszölle setzen der Automobilwirtschaft zu, die global mit Zielmärkten auf der ganzen Welt stark verflochten ist. Dazu kommen hohe Standortkosten, die sie zusätzlich belasten. Der Verkauf von Pkws und Lkws befindet sich in Europa unter dem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zudem hat sich das Kaufverhalten nicht wie prognostiziert entwickelt. Die Folge ist, dass nicht nur im deutschen Markt, sondern auch in großen Teilen der Europäischen Union, der Vertrieb batterieelektrischer Fahrzeuge nur schleppend verläuft. In China hingegen dominiert die Elektromobilität den Markt.
Die Europäische Union muss die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Automobilwirtschaft stärken und für optimale Standortbedingungen angesichts sich drastisch verändernden geopolitischen Rahmenbedingungen sorgen und gleichzeitig die Transformation und Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors ambitioniert voran-treiben. Die Automobilwirtschaft ist Europas Innovations-, Forschungs- und Wohlstandsmotor. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Europäische Kommission nach dem Beispiel des Strategiedialogs in Baden-Württemberg einen Strategischen Dialog für die Automobilwirtschaft eingerichtet hat.
Wir müssen mit vereinten Kräften die Rahmenbedingungen insbesondere für einen beschleunigten Rollout der Elektromobilität in Deutschland und Europa verbessern und wenn notwendig durch ein flexibleres Vorgehen Strukturbrüche vermeiden. Dafür benötigt es auch auf EU- und Bundesebene ein regelmäßiges Monitoring, um die Rahmenbedingungen und Fortschritte für den Hochlauf der Elektromobilität entsprechend engmaschig und fortlaufend zu analysieren und bewerten sowie Maßnahmen zu entwickeln. Aber auch erneuerbare Kraftstoffe dürfen nicht aus dem Blick verloren werden.
Mit den nachfolgenden Punkten bringt sich Baden-Württemberg in den Strategiedialog der Europäischen Kommission ein und möchte mit dem Netzwerk des Strategiedialogs aus Baden-Württemberg daran partizipieren. Zudem bitten wir die Europäische Kommission, dies im angekündigten „Clean Industrial Plan for the Automotive Sector“ zu berücksichtigen.
Bereits in den Jahren 2030 und 2035 treten weitere Stufen zur Einhaltung der Flottengrenzwerte in Kraft. Daher brauchen wir eine schnelle Zwischenbilanz auf dem Weg zur Erreichung der CO2-Flottenziele. Zur Frage einer vorgezogenen Überprüfung der Flottengrenzwerte jeweils um ein Jahr auf 2025/2026 und Flexibilisierung bei den Strafzahlungen bis hin zu deren möglichen Aussetzung wollen wir schnellstmöglich in Gespräche mit der Europäischen Kommission eintreten. Die Entscheidung darüber muss schnell getroffen werden und Gegenstand des neuen Strategischen Dialogs mit der Automobilwirtschaft sein. Unsere Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Das Ziel der Klimaneutralität darf dabei nicht in Frage gestellt werden, aber wir brauchen mehr Flexibilität auf dem Weg dorthin.
Unsere Automobilwirtschaft und ihre Beschäftigten sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen Klarheit darüber gewinnen, ob die Rahmenbedingungen zur Erreichung der Flottenziele, wie sie in Artikel 15 (1) der einschlägigen Verordnung niedergelegt sind, vorhanden sind und welche unterstützenden Maßnahmen die Europäische Kommission auf den Weg bringen wird. Auch die Angemessenheit der Strafhöhen soll in Anbetracht einer veränderten geopolitischen Situation auf den Zielmärkten unter anderem in China und den USA im Rahmen des Reviews und des Strategiedialogs der Europäischen Kommission ebenfalls geprüft werden.
60 Prozent der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Pkw-Bereich in der Europäischen Union entfallen aktuell auf die drei Länder Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Für einen beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität müssen wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur und den Ausbau der H2-Tankinfrastruktur in der gesamten Europäischen Union ambitionierter voranbringen. Der Ausbau der Elektromobilität und damit der Ladeinfrastruktur muss sich an den gesetzlich vereinbarten CO2-Reduktionszielen orientieren. In Deutschland muss der Masterplan LIS II konsequent umgesetzt werden. In der Europäischen Union muss das Ambitionsniveau der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zeitnah angehoben und die Umsetzung in allen EU-Staaten einem regelmäßigen Monitoring unterzogen werden. Dazu müssen die Anstrengungen der Finanzierung der Lade- und Tankinfrastruktur für E-Pkw und E-Lkw auf allen Ebenen verstärkt werden. Baden-Württemberg hat mit dem Strategiedialog bereits ein flächendeckendes Ladenetz für E-Pkw ausgerollt. Zudem müssen die Netzanschlüsse für den Rollout der Elektromobilität bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Wie teuer das Aufladen an den Ladesäulen ist, ist für die Kaufentscheidung für E-Autos sehr wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass die Energiekosten für das Laden von E-Fahrzeugen dauerhaft gesenkt werden. Langfristige Anreize wie eine dauerhafte Senkung der Ladekosten (beispielsweise über die Absenkung der Stromsteuer oder der umgelegten Netzentgelte) sollten kurzfristig umgesetzt werden. Die Senkung der Energiekosten ist gegenüber Prämienmodellen als Kaufanreiz ein nachhaltiger wirkendes Instrument. Wir brauchen deutliche, nachhaltige und zuverlässige Marktsignale in Richtung der Elektromobilität. Die Elektromobilität sollte EU-weit längerfristig und planungssicher unterstützt werden. Dazu müssten EU-weite Maßnahmen wie zum Beispiel kostenloses Parken von der Kommission gefördert oder Anreize dafür geschaffen werden. Anreize sind beispielsweise die Einführung einer Sonder-Abschreibung für neu zugelassene vollelektrische und vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge, ein Förderprogramm für den Ausbau der öffentlichen und privaten Ladeinfrastruktur sowie faire Wettbewerbsbedingungen bei den Ladetarifen sowie der Abbau der Hemmnisse beim bidirektionalen Laden.
Baden-Württemberg wird als Land Baugenehmigungen für die mit der Ladeinfrastruktur zusammenhängenden technischen Nebenanlagen (zum Beispiel Trafo-Stationen) ab-schaffen. Die Errichtung von Ladestationen ist bereits heute verfahrensfrei gestellt. Diese Erleichterungen sollten in ganz Europa ausgerollt werden. Weitere Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung sollten geprüft und umgesetzt werden, um die Attraktivität des Standorts zu erhöhen und Investitionen zu erleichtern.
Automobilwirtschaft und Politik tragen beide eine große Verantwortung dafür, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Elektromobilität zu stärken. Dazu gehört eine Positivkommunikation, die von der Politik und Wirtschaft gemeinsam getragen wird. Die Automobilwirtschaft ist auch angehalten, durch bezahlbare Elektroautos einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Wir brauchen ferner Maßnahmen zur Förderung der Nachfrage zum Beispiel in Form von Steuererleichterungen sowie nachhaltige Marktsignale durch einen reduzierten Stromladepreis für mindestens zehn Jahre. Solche Maßnahmen müssen EU-weit wirken.
Asiatische Hersteller von Fahrzeugen und Zulieferer haben in den vergangenen Jahren im Fahrzeugbau und insbesondere bei der Elektromobilität stark aufgeholt und drängen auf die Märkte. Nicht selten sind die chinesischen Fahrzeuge günstiger als die Fahrzeuge europäischer Hersteller. Der freie Handel zwischen den USA und China wird zunehmend eingeschränkt; dieser Handelskonflikt stellt eine zusätzliche Hürde für die Absatzmärkte der Zukunft dar. Europa und Deutschland müssen für gleiche Wettbewerbsbedingungen, die auf Gleichheit und Fairness beruhen, sowie eine Stärkung der WTO eintreten. Wichtig ist, dass die Europäische Union neue bi- und multilaterale Handelsabkommen wie etwa mit Mercosur abschließt und den fairen, freien und regelbasierten Handel stärkt. Handelszölle mit China müssen wir auf dem Verhandlungsweg vermeiden. Im Rahmen der Verhandlungen könnten dabei als letztes Mittel auch Ausgleichszölle der EU ins Schaufenster gestellt werden. Auch Handelszölle der USA müssen auf dem Verhandlungsweg vermieden werden.
Deutschlands Automobilwirtschaft gehört zu den innovativsten der Welt. Unsere Unternehmen investieren Milliarden in die Forschung und Entwicklung neuer Antriebstechnologien, Digitalisierung und Vernetzung sowie Technologien für das autonome Fahren. Neben der Frage nach der Art des Antriebes wird die Digitalisierung entscheidend für die Zukunft eines wettbewerbsfähigen Automobilmarktes sein. Die Automobilindustrie weist die höchsten FuE-Investitionen vor: 31 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Auftragsforschung sind im Automobilsektor um 19,1 Prozent angewachsen. Dabei ist die Sparte mit den höchsten Steigerungsraten die IKT-Branche. Dies macht deutlich, dass wir verstärkt die Sparten vernetzen und „kollaborative Forschung und Entwicklung“ – auch in Kooperation mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen – fördern müssen.
Unsere Unternehmen benötigen Unterstützung, zum Beispiel in Form von vereinfachtem Zugang zu Krediten und Bürgschaften sowie Förderprogrammen der Bundesregierung für die Transformation zu klimaneutraler Produktion und Produkten.
Bei der Förderung modernster Batteriezelltechnologien brauchen wir einen langen Atem. Wir fordern die Europäische Union auf, im Rahmen des Aktionsplans für eine wettbewerbsfähige Europäische Batterieindustrie die Maßnahmen so auszugestalten, dass Unternehmen in wirtschaftsstarken Transformationsländern davon profitieren können. Darüber hinaus spielen Rohstoffpartnerschaften zur Sicherung der Lieferketten eine wichtige Rolle.
Das Chipdesign und die Chipfertigung sollten in Europa weiter vorangebracht werden. Dafür eignet sich das Förderinstrument Important Project of Common European Interest besonders gut. Zum einen geht es um neue, energiesparende, hochintegrierte Chips für das software-defined vehicle, zum anderen um die Absicherung der Lieferketten und eine resiliente Produktion. Auf EU-Ebene wurde mit dem European Chips Act ein guter Förderrahmen geschaffen.
Auch die Länder leisten – trotz einer angespannten Haushaltslage – ihren Beitrag. Baden-Württemberg investiert Milliarden in eine Innovations- und Zukunftsagenda. Die Europäische Union, Deutschland und Länder müssen bei einer ambitionierten In-novationsagenda Kurs halten. Auf europäischer Ebene setzen wir uns für die Ausweitung der Important Project of Common European Interest für weitere Bereiche der Automobilwirtschaft wie beispielsweise das autonome Fahren und Software im Fahrzeug als einer Leitbranche Europas ein. Dabei sollten gerade auch die kleinen und mittleren Unternehmen verstärkt gefördert werden.
Wir brauchen zudem eine Modernisierung des EU-Beihilfenrechts. Das europäische Beihilferecht sollte im Sinne der Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU an die Transformationsbedürfnisse wirtschaftsstarker und innovativer Ökosysteme angepasst werden. Europa muss in der Lage sein, die Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien sicherzustellen – gerade in einer Zeit, in der der Transformationsdruck in Regionen wie Baden-Württemberg besonders spürbar ist. Innovationstarke Transformationsregionen sind derzeit durch das EU-Beihilferecht mit seinem Fokus auf wirtschaftsschwache Regionen innerhalb der EU benachteiligt und werden dadurch in ihrem Transformationsprozess ausgebremst. Gerade diese starken Regionen sind aber unverzichtbar, um den industriellen Wertschöpfungsprozess global auf eine klimaneutrale Produktion umstellen zu können.
Erneuerbare Kraftstoffe sind teuer und knapp und werden aufgrund fehlender Alternativen vor allem im Luft- und Schiffsverkehr sowie teilweise im Lkw-Verkehr benötigt, um die Klimaziele zu erreichen. Daneben werden Potenziale für die Pkw-Bestandsflotte gesehen. Es sollte von allen Beteiligten die Erwartung deutlich unterstützt werden, dass die Elektromobilität gerade im Pkw-Sektor aufgrund von Effizienzvorteilen die dominante Antriebsart darstellen wird (Wirkungsgrad von 95 Prozent). Dies ist auch wichtig, um einer Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher entgegenzuwirken. Diskussionen über mögliche Anpassungen in der Regulierung dürfen nicht als Abkehr von der Elektromobilität missverstanden werden. Der diesbezüglichen Review-Diskussion im Sinne der sozialen Akzeptanz und eines erfolgreichen industriellen Übergangs mit möglichen Flexibilisierungen will dieses Papier explizit nicht vorgreifen. Eine gute Regulierung für klimaneutrale Mobilität setzt nicht zuletzt auf Technologieoffenheit. Die Bundesregierung und die Europäische Union müssen daher auch neue Förderprogramme für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe aufsetzen und die Regulierung so anpassen, dass eine Marktentwicklung ermöglicht wird. Gerade ein zu enger regulatorischer Rahmen auf europäischer Ebene ist derzeit das größte Hindernis für den Hochlauf von erneuerbaren Kraftstoffen. Auch braucht es für den Hochlauf der Elektromobilität verbraucherfreundliche Preise.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen weitere Schritte unternehmen, um den Standort Europa im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu halten. Bei Ansiedlungen von Unternehmen und Start-ups muss Europa wieder „the place to be“ werden. Dazu gehören beispielsweise bezahlbare und international konkurrenzfähige Energiepreise und ein spürbarer und deutlicher Abbau von Bürokratie. Europa muss auf eine innovationsfreundliche Regulierung setzen, mit deutlich mehr Gestaltungsspielraum und Freiheiten bei der Umsetzung. Der Transfer von Innovationen in die Wirtschaft, die Förderung von Talenten und eine Verbesserung des Venture Capitals bleiben top aktuell und benötigen schneller Lösungen. Dazu gehört es auch, dass die Regulierungen der Europäischen Union deutlich entschlackt werden.
Europa braucht eine innovationsfreundliche Regulierung, welche neben den Klimazielen die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilwirtschaft stärkt. Ein Strategischer Dialog der Europäischen Union muss jetzt zügig eingesetzt werden.
Baden-Württemberg wird sich mit dem eigenen Netzwerk des Strategiedialogs mit ganz konkreten Konzepten in den geplanten Strategischen Dialog auf europäischer Ebene einbringen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Automobilwirtschaft zu stärken. Baden-Württemberg begrüßt zudem die Ankündigung eines „Clean Industrial Plans“ für den Automobilsektor. Es müssen wieder die Innovationskraft unserer Unternehmen, optimale Standortbedingungen und eine innovationsfreundliche Regulatorik in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Automobilwirtschaft muss als Job- und Fortschrittsmotor bei der Transformation nach Kräften unterstützt werden. Dabei müssen Dekarbonisierung, Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit zusammen gedacht werden. Dafür werden wir uns stark machen.